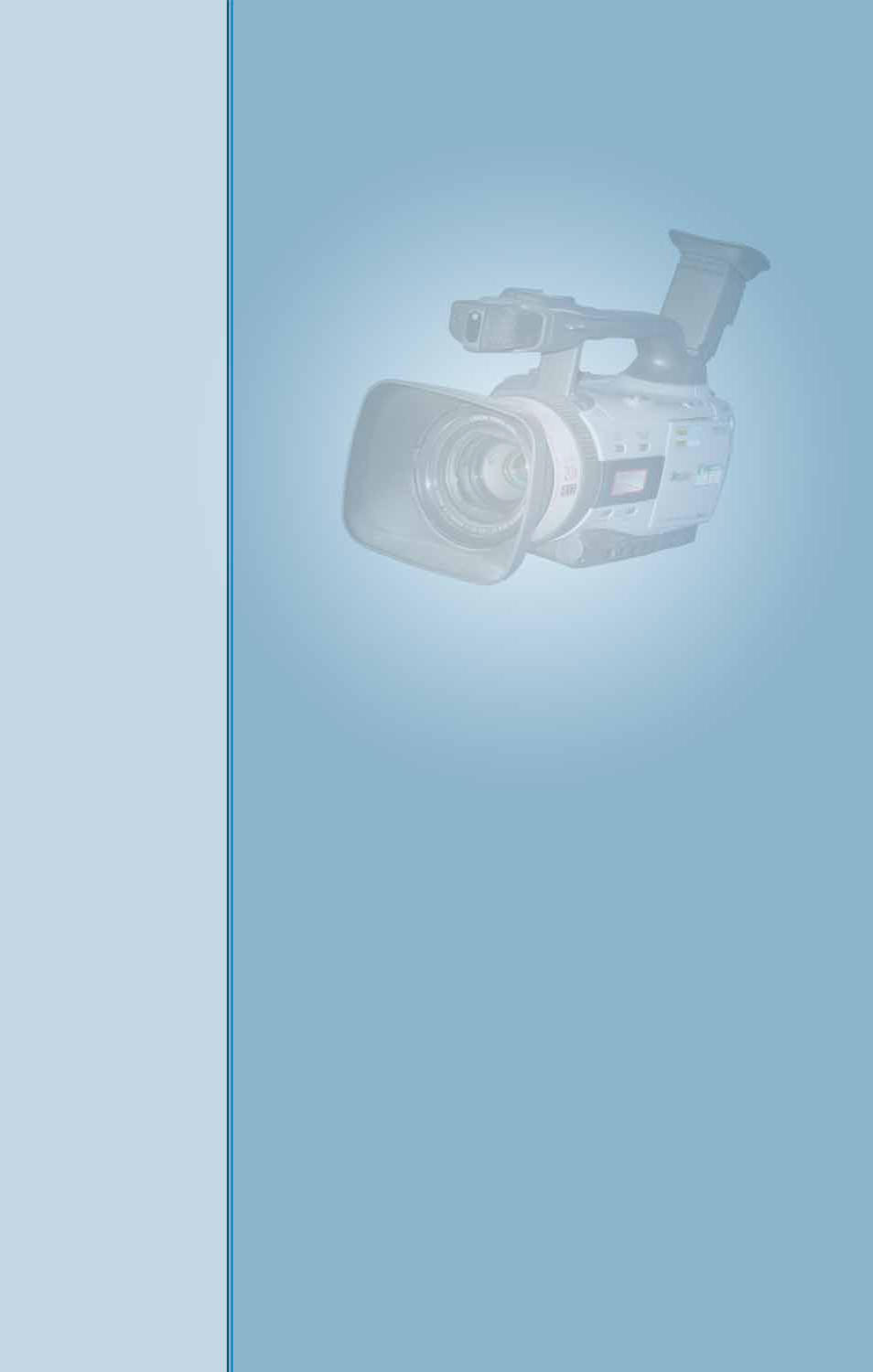




ZVR: 659600647
|
|

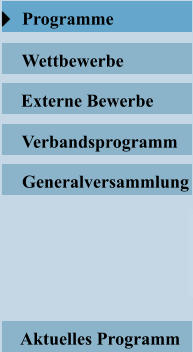
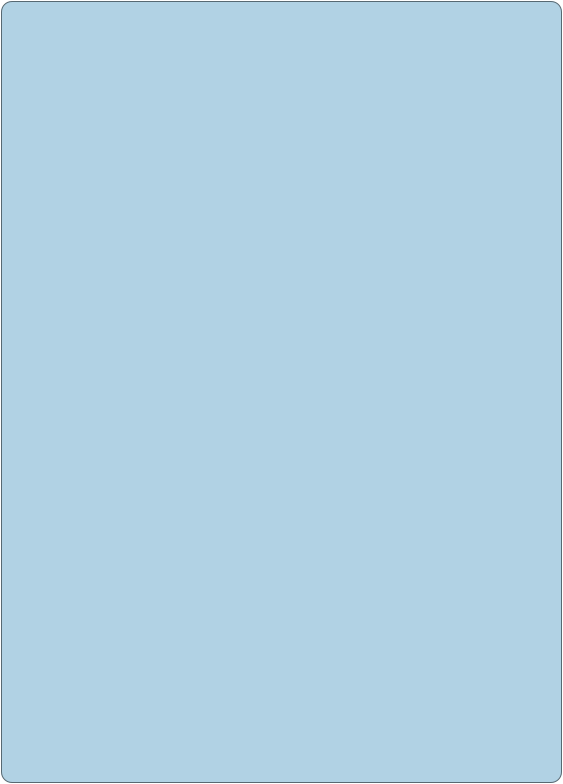
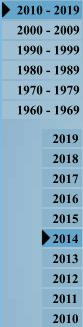
Es
ist
–
wie
im
ersten
Film
–
wiederum
die
von
Sonja
Stegers
Kamera
geschaffene
Distanzlosigkeit,
die
mich
positiv
für
den
Film
einnimmt:
das
sich
Mittendrin
befinden.
War
es
jedoch
beim
Markttag
in
Kashgar
allein
der
Adabei
-Faktor
des
Hineinschnupperns
der
mich
in
Banne
zog,
so
ist
es
bei
diesem
Streifen
eine
andere,
an
Grundsätzlicherem
rührende
Unmittelbarkeit, die mich begeistert.
Zum
Einen
fasziniert
mich
die
Art,
wie
es
der
Filmemacherin
gelingt,
die
Alltäglichkeit
des
Todes
in
all
ihrer
Beiläufigkeit,
aber
gleichzeitig
in
all
ihrer
Essenz
zu
dokumentieren:
Man
sieht
die
Gruppe,
sich
unterhaltend,
den
Weg
zum
nächsten
Dorf
entlang
wandern.
Am
Wegesrand
brennt
ein
Feuer.
Durch
eine
kurze
Nah-Aufnahme
wird
einem
bewusst,
dass
hier
ein
menschlicher
Körper
liegt
und
dass
Flammen
gerade
noch
an
ihm
nagen.
Ein
angekohltes
Bein
samt
Fuß
ragt
schräg
nach
oben
.
Ein
memento
mori
.
Eine
-
für
Sekunden
bloß
-
aufflackernde
Erinnerung
an
unsere
Sterblichkeit,
an
die
Vergänglichkeit
alles
Seienden.
Unlängst
hat
die
amerikanische
Poetin
und
Sängerin
Lucinda
Williams
ihr
neuestes
Werk
veröffentlicht.
Warum
ich
das
erwähne?
Nun,
sie
nennt
es
Down
where
the
spirit
meets
the
bone
.
Wäre
die
oben
geschilderte
Brandbestattung
als
Fotographie
verewigt
worden,
so
meine
ich,
müsste
diese
mit
eben
diesen
sieben
Worten
untertitelt
werden.
Treffender
und
sprachlich
schöner
könnte
man
Gesehene
wahrlich
nicht
zusammenfassen.
Lucinda
Williams
verweist
mit
diesem
Zitat
aus
dem
Lied
„
Compassion
“
(Leidenschaft)
auf
jene,
unsere
Seelen
aufwühlenden
und
mitunter
sogar
unsere
Leben
zerrüttenden
Momente,
in
denen
das
Spirituelle
auf
den
Knochen
trifft:
Das
Transzendente
auf
das
Materielle.
Das
Gute
auf
das
Böse.
Das
Geistige,
Philosophische
auf
das
Körperliche.
Das
vielleicht
allzu
Menschliche.
Auf
den
Kern
der Sache. Auf das Wesentliche.
Und
dieses
Wesentliche,
Letztgültige
wird
durch
Sonja
Stegers
filmischen
„Schnappschuss“
grandios
freigelegt.
Es
liegt
natürlich
im
Auge
des
Betrachters,
aber
ich
sehe
insbesondere
in
der
Kürze
dieser
Verbrennungssequenz
–
sie
dauert
kaum
länger
als
einen
Wimpernschlag
–
den
Schlüssel,
der
mir
die
Tür
zur
Symbolik
hinter
dieser
eindringlichen
Abbildung
eines
kremierenden
Leichnams
öffnet.
Sein
fast
unbemerktes
Vorbeihuschen
an
unseren
Netzhäuten,
lässt
diesen
Menschen,
dessen
glosende
Gebeine
wir
nur
einen
winzigen
Moment
lang
bewusst
wahrnehmen,
nämlich
zu
einer
Randerscheinung
schrumpfen
und
so
zur
Nebensächlichkeit
zerbröseln,
jedoch
zu
einer
bloß
scheinbaren.
Tatsächlich
erfährt
er
in
meinen
Augen
eben
gerade
dadurch,
dass
seine
Kremation
nur
ganz
knapp
nicht
übersehen
wird,
eine
Verwandlung.
Die
Verwandlung
in
ein
Bild.
Ein Bild, das mehr sagt als tausend Worte.
Eine
Metapher.
Eine
Metapher
für
die
tragenden
Mauern
jenes
philosophischen
Gedankengebäudes
in
dem
die
Menschen
dieses
Teils
des
Orients
seit
vielen
Jahrhunderten
ihre
Heimstatt
und
ihr
existentielles
Selbstverständnis
finden.
Die
Bengalen
empfinden
sich,
wie
der
überwiegende
Teil
der
Bevölkerung
Indiens,
als
Teil
des
kosmischen
Ganzen,
gleich
und
daher
auch
eins
seiend
mit
Tieren
und
Pflanzen.
Sie
nehmen
dieses
Gebäude
allerdings
als
Rad
wahr.
Als
ewig
sich
drehendes,
kosmisches
Rad
des
Werdens
und
Vergehens,
der
Wiedergeburt
und
des
Sterbens.
Ein
Rad,
als
Passagiere
dessen
sie
sich
verstehen.
In
dessen
Vorsehung
für
sie,
sie
sich
widerspruchslos
fügen.
Der
Tod
ist
für
sie
Erlösung,
das
sich
Entfesseln
von
einer
Reinkarnation
für
die
nächste.
Eine
Art
Häutung,
um
von
einer
Haut
in
die
neue
für
sie
-
gemäß
ihres
Karmas
,
soll
heißen:
gemäß
ihres
aus
den
Vorleben
mitgeschleppten
und
zu
tilgenden
Schuld-Kontostandes
–
bereit
liegende
zu
schlüpfen.
Fortsetzung



