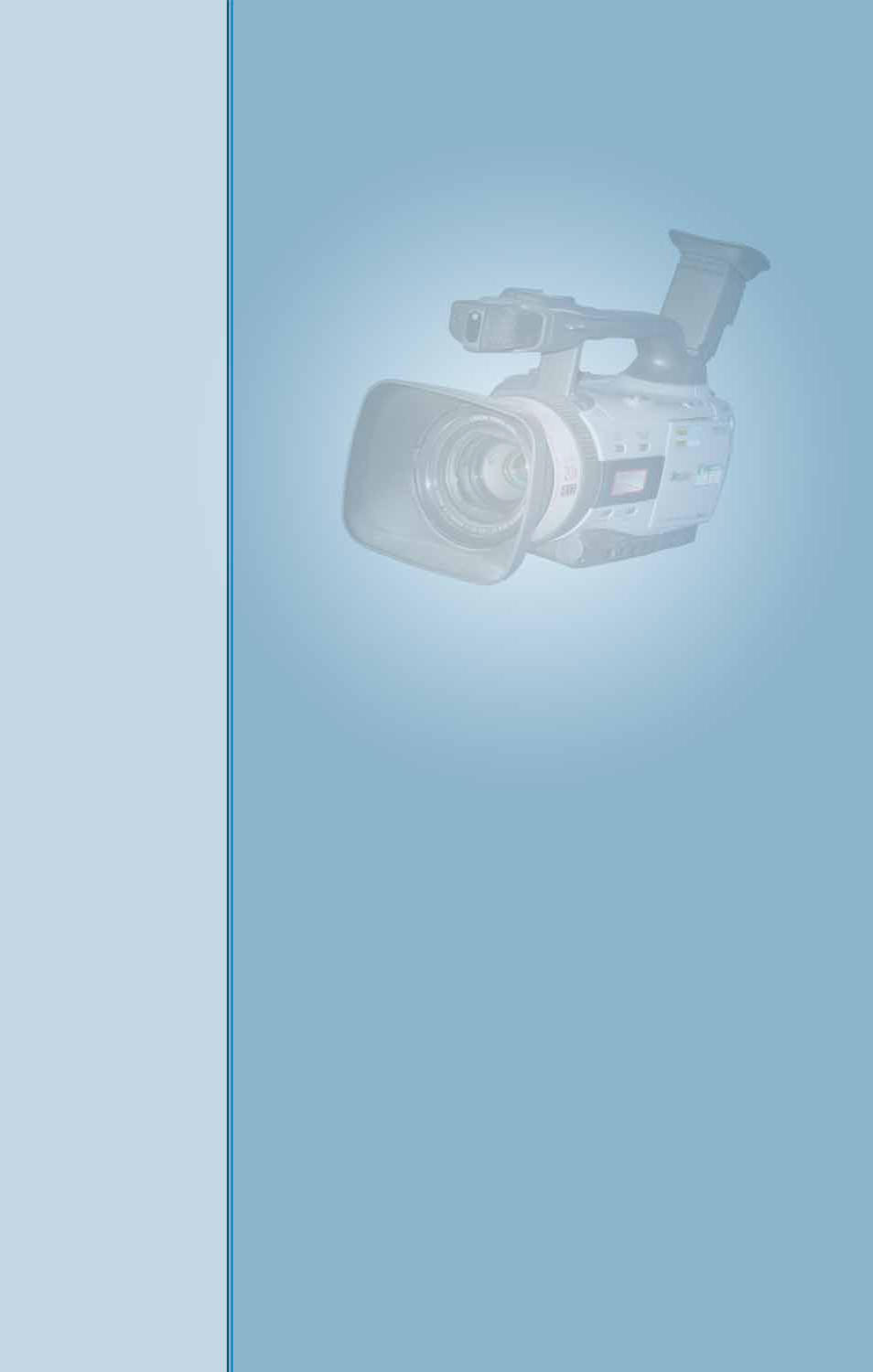




ZVR: 659600647

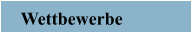




















|
|






















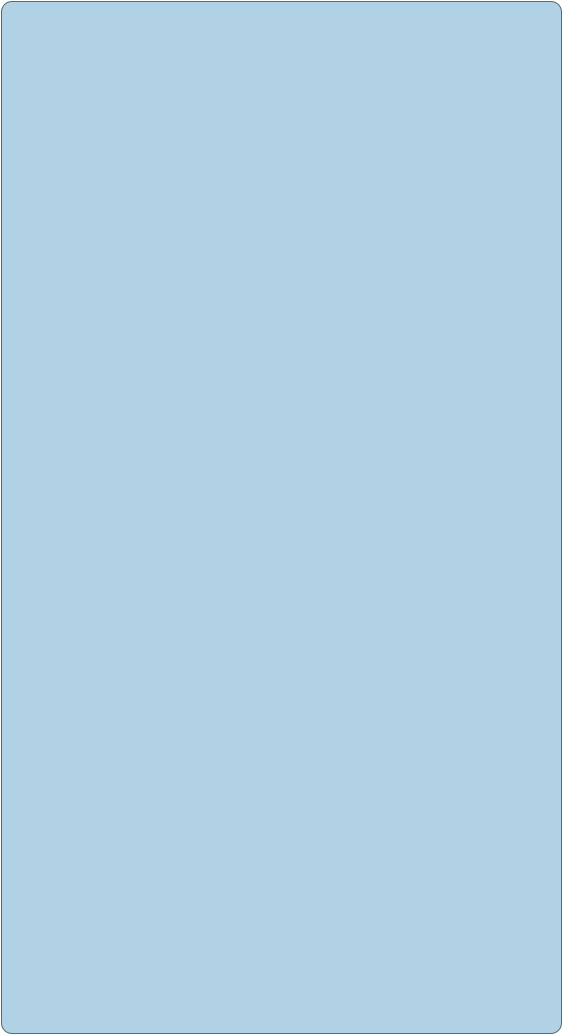
18.10.2005: Autorenabend Renate Wihan, Salzburg
Der
Stamm
der
Fischmenschen
hatte,
so
erfahren
wir
in
Renate
Wihans
Film
Traumzeit
von
der
-
dem
Film
Authentizität
verleihenden
-
australisch
sprechenden
Erzählstimme,
bis
ihn
das
Feuer,
aufgestachelt
durch
einen
bösen
Wind,
ins
Meer
trieb,
an
der
Küste
Australiens
gelebt.
Den
Fischmenschen,
so
will
es
die
uns
zu
Ohren
gebrachte
Legende
der
australischen
Ureinwohner
weiter,
gefiel
es
in
dem
ihnen
durch
den
Furor
der
Elemente
aufgezwungenen
Exil
so
gut,
dass
sie
beschlossen,
es
zu
ihrem
Zuhause
zu
machen.
Die
Salzburgerin
ist
selbst
seit
18
Jahren
Taucherin
und
seit
1995
hält
sie
ihre
Unterwasser-Expeditionen
in
bewegten
Bildern
fest.
Sie
ist
definitiv
einer
dieser
Fischmenschen.
Die
Welt
unter
dem
Meeresspiegel
ist
ihr
zur
zweiten
Heimat
geworden,
ihre
Bewohner
sind
Töchter
und
Söhne
ihres
Stammes.
Mit
Traumzeit
das
auch
als
die
Quintessenz
der
Aboriginesage
widerspiegelnde
Homestory
gesehen
werden
kann,
untermauert
die Filmemacherin nicht nur die Geschmacksicherheit ihrer Vorfahren.
Renate
Wihan
interessiert
sich
aber
nicht
nur
für
die
Mythologie
ihrer
Ahnen,
sie
betreibt
auch
Heimatforschung.
In
ihren
Arbeiten
porträtiert
sie
das
reiche
Leben
unter
den
Meereswellen
und
-
wie
in
Schwarze
Perle
und
Rurutu
-
das
Leben,
das
die
Fischmenschen,
hätten
sie
an
Land
bleiben
können,
möglicherweise
heute
auch
führen
würden.
Sie
erkundet
in
manchen
ihrer
Werke
aber
auch
die
Möglichkeiten,
die
ihr
ihre
ureigenste
Heimat,
ihre
körperliche
Existenz,
bietet
-
und
deren Grenzen.
Der
Treibstoff
für
ihr
filmisches
Engagement
ist
daher
nicht
die
Gier
nach
der
all
das
bisher
Gesehene
übertreffenden
Filmsequenz
und
auch
nicht
der
Drang
unbedingt
aufklärend
wirken
zu
müssen.
Alles,
das
sensationelle
neue
Bild,
wie
auch
die
etwaige
Aufklärung
über
die
wirklichen
Sachverhalte
sind
oft
nur
–
so
scheint
es
–
Nebenprodukte,
unaufdringliche,
aber
mit
gutem
Gefühl
dosierte Würze.
Was
die
Filmerin
wirklich
vorantreibt,
ist
ein
bis
ins
Existenzielle
reichendes,
persönliches
Interesse.
Das,
was
sie
-
wie
im
Film
Abenteuer
Weißer
Hai
eindrucksvoll
festgehalten
-1996
vor
der
Küste
Südafrikas
dazu
bringt
einem
„Großen
Weißen“
ins
Maul
zu
schauen,
ist
das
Bedürfnis
ES
wissen
zu
wollen.
Bezeugt
wird
diese
kribbelnde
Lust
an
der
physischen
und
psychischen
Grenzerfahrung
auch
in
Abenteuer
Malpelo
,
als
die
Taucherin
samt
ihrer
Kamera
in
das
atemraubende
Dunkel
des
Pazifiks
70
Meter
tief
hinab
gleitet,
um
dort
eine
neue
Haiart
in
ihrem
Lebensraum
aufzuspüren.
Hautnah
lässt
sie
uns
auch
den
Kitzel
spüren,
den
es
wohl
für
einen
Taucher
bedeutet,
langsam,
den
Tiefenrausch
als
bedrohlichen
Schatten
stets
neben
sich,
den
wachsam über ihn kreisenden Haien entgegen zu steigen.
Auch
wenn
die
Filmemacherin
schlussendlich
nur
fand,
was
sie
(vielleicht)
ursprünglich
gar
nicht
vor
hatte
auf
Filmmaterial
zu
bannen,
nämlich
eine
Gruppe
illegaler,
nicht
zimperlicher
„Haifischflossenschneider“,
so
belegt
dieser,
an
den
richtigen
Stellen
grandios
düstere
Film,
dass
sie
sich
-
wie
schon
im
Streifen
Schwarze
Perle
-
auch
dem
Aufzeigen
und
Festhalten
des
Tierleids
verschrieben
hat.
Wohnten
im
Film
über
die
Perlenzüchter
allerdings
noch
zwei
Seelen
in
ihrer
Brust
–
die
von
Schönheit
oft
geblendete
ästhetische,
als
auch
die,
sich
mit
Vehemenz
durch
den
fokussierten,
detailgenauen
Blick
auf
die
an
den
Muscheln
vorgenommenen
Manipulationen
offenbarende,
einfühlsame
emphatische
-,
so
weist
sie,
ganz
Fischmensch,
in
Abenteuer
Malpelo
unzweideutig
auf
das
den
Haien
durch
die
befremdlichen
Essgelüste
einiger
Menschen
aufgezwungene Martyrium hin.
Dass
ihr
neben
dem
ungeschönten
Dokumentieren,
das
Darlegen
von
(ökologischen)
Vernetzungen
ein
Anliegen
ist,
zeigt
Renate
Wihan
eindringlich
mit
der
populärwissenschaftlichen
Montage
Galapagos
El
Nino
.
Mit
extrem
naturalistischen
Aufnahmen
bis
auf
die
Knochen
abgemagerter
Robbenbabys,
müder,
über
tote
Artgenossen
kriechender
Leguane
und
eines
fischleeren
Meeres
unter
bleiernem
Himmel
zeichnet
sie
darin
zunächst
in
Todesfarben
ein
herzzerreißendes
Bild
von
den
Auswirkungen
eines
das
Wasser
erwärmenden
El
Ninos
auf
ein
wohl
austariertes
empfindliches
Naturgeflecht.
Den
Worten
eines
Wildtierhüters
folgend,
wonach,
sofern
sich
der
Mensch
nicht
einmische,
der
Tierbestand
sich
bald
wieder
erholen
werde,
übermalt
sie
jedoch
gegen
Ende
des
Filmes
ihr
apokalyptisches
Fresko
mit
helleren
Farben.
Der
französisch
erzählende
Film
OM,
Urlaut
des
Sein
ist
im
Grunde
nichts
anderes
als
eine
auf
der
Orgel
des
Schnittcomputers
gespielte
Hymne
auf
die
in
Galapagos
El
Nino
angedeutete,
universelle,
unverwüstliche
Lebenskraft.
Er
ist
aber
auch
prunkvolle
Proklamation
des
gleichsam
allen
Geschöpfen
Innewohnenden
und
Gemeinsamen.
Für
mich
ist
diese
Reflexion,
die
viel
ihrer
meditativen
Kraft
nicht
zuletzt
aus
der
Harmonie
zwischen
der
französischen
Sprachmelodie
und
den
einprägsamen
Bildern
schöpft,
kreativer
Ausdruck
der
aus
der
Summe
aller
Erkenntnisse
des
Fischmenschen
Renate
Wihan
entspringenden
Ultima
Ratio
–
oder
schlicht
der,
den
Kreis
schließende Lichtpunkt.
Charly Liebhaber



